Gerade das Englische spiegelt in seinem großen Bestand an Lehn- und Fremdwörtern den kulturellen Einfluss der römischen Vorherrschaft in Europa wider. Das hat sich auf die englische Hochsprache ausgewirkt, während die Alltagssprache durch sächsische Sprachelemente gekennzeichnet war. Später war die Nähe zu den nordfranzösischen Normannen, die England auch kulturell und politisch nahestanden, prägend. Deshalb gibt es im Englischen so viele Wörter, die dem Lateinischen und sogar dem Griechischen entlehnt sind.
„to gender“ ist das englische Verb, das gendern zugrunde liegt. Es bedeutet, ein personenbezogenes maskulines Wort mit einer femininen Nachsilbe zu versehen, um es als Femininum explizit zu kennzeichnen. Es kommt aus dem Lateinischen. Darin enthalten ist zunächst gens, Volksstamm, schließlich genus, Geschlecht, Herkunft.
Auch im Deutschen gibt es Fremdwörter, die darauf Bezug nehmen: z. B. Genus – grammatisches Geschlecht, Gen – Erbgutträger, generisch – beide Geschlechter umfassend, weiter von Generikum – dem Original vergleichbares Medikament, bis Gentrifizierung – Aufwertung und Verteuerung eines Stadtteils. Das darin enthaltene Wort gentry, niederer Adel, ist von dem altfranzösischen genterie, Adel, abgeleitet.
Heute gendert man, um eine Zurücksetzung von Frauen auszuschließen. Verstand man früher unter einem Wort mit männlicher Nachsilbe, z. B. der Einwohner, dessen männliches grammatisches Geschlecht, durch die Nachsilbe -er gekennzeichnet war, sowohl männliche als auch weibliche Menschen, so sieht man heute die Notwendigkeit zu differenzieren, um Frauen nicht hinter Männern zurückzusetzen. Die Verständigung darüber betrifft nur das grammatische, nicht aber das sexuelle Geschlecht. Das generische Maskulinum beansprucht, beide Geschlechter zu umfassen, während ihm neuerdings unterstellt wird, Frauen nur mitzumeinen . Aus diesem Missverständnis hat sich das Verständnis einer Herabsetzung von Frauen ergeben. Deshalb spricht man heutzutage ‚gendergerecht‘ von Einwohnerinnen und Einwohnern, Einwohnenden, EinwohnerInnen oder Einwohner*innen, oder gendergerecht gesprochen Einwohner_Innen. Auf diese Weise wird das ursprünglich wertfrei gebrauchte grammatische Geschlecht zum sexuellen Geschlecht umgedeutet. Dadurch erst entsteht eine Belastung, die dem unvoreingenommenen Sprecher aufgebürdet wird. Um nicht als frauenfeindlich zu gelten, unterwirft er sich grammatisch und semantisch fragwürdigen Regeln.
Im Indogermanischen, dem Urspung vieler europäischer Sprachen, ist es üblich, keinen grammatischen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Wesen zu machen. Die Trennungslinie verlief also nur zwischen Lebewesen und Dingen. Im Lateinischen, das dem Griechischen nahe verwandt ist, ist das daran erkennbar, dass Wörter, die auf -s endeten, sowohl männliche als auch weibliche Bedeutung haben konnten. Erst als im späten Indogermanischen, als das -a als weibliche Genusmarkierung entstand, konnte man durch ein adjektivisches Attribut Geschlechtsunterschiede verdeutlichen: dux bonus versus dux bona. Ähnlich mag es sich mit rex, König, verhalten haben, bevor regina – Königin, mit der Zunahme internationaler Politik Roms notwendig wurde. Denn in Rom bestimmten Männer Politik und Militär. Mit zweiendigen Adjektiven und Präsenspartzipien, die der gemischten Deklination folgen, verhält es sich ähnlich. Unterschieden wird nur das sächliche Geschlecht.
Dagegen soll jedes maskuline Wort im Deutschen, mit einer femininen Endung versehen, zu einer Differenzierung in Männer und Frauen führen. Diese Sichtweise sieht es nicht als selbstverständlich an, dass die Mitglieder eines Gemeinwesens aus Männern und Frauen, also aus Mitgliedern beiderlei Geschlechts, bestehen. Sie beansprucht eine bewusste Nennung femininer Begriffe neben den maskulinen.
Sprache ist eigen, dass sie, statt etwas mitzumeinen, die kürzere Form als Standardgenus verwendet. Das nennt man fachsprachlich Ikonisierung und bedeutet übergreifendes Zeichen oder Kürzel, eine Art icon, Symbolbild oder Piktogramm. Das Wort ist aus dem Griechischen entlehnt, wo εἰκών Bild heißt. In diesem Sinne ist unter Ikoniserung zu verstehen, dass ein männliches – naturgemäß kürzeres – Wort als Verbildlichung der ihm entlehnten weiteren Genera fungiert. (1)
Heute versucht man, feminine Mitgemeintheiten durch sprachliche Neuschöpfungen zu ersetzen. Üblicherweise spricht man demgemäß also in offiziellen Zusammenhängen von Richterinnen und Richtern oder von Richter*innen, von RichterInnen oder Richtenden. Abgesehen davon, dass die Lesefreundlichkeit und der gute Stil dafür geopfert werden, ist zu spüren, dass -innen und entsprechende Zeichen bereits zu Automatismen geführt haben, denen bisweilen widersinnige Wortbildungen entspringen. Das übernimmt man neuerdings im Mündlichen, um deutlich zu machen, dass man das weibliche Geschlecht mitbezeichnet, indem das beim Sprechen durch eine kleine Pause angedeutet wird: Das klingt etwa wie „Lehrer…Innen“. Differenziert wird dann allerdings im moralischen Kontext: Geht es um Vergewaltigung oder Raub und Mord, verzichtet man eher auf das Gendern.
Als ähnlich angestrengt erscheint es, wenn Indefinitpronomen – „der andere und die andere“, „keiner und keine“ oder „jeder und jede“ – dem erzwungenen Gendern zum Opfer fallen. Indefinitpronomen sagt ja bereits aus, dass die Person (2) nicht genauer bezeichnet werden muss.
Im Mittel- und Althochdeutschen war das Indefinitpronomen man eine Bezeichnung für ein denkendes und aufrecht gehendes Wesen. Es differenzierte also nicht zwischen Frau und Mann. Aus dem Substantiv Mann, männlicher Mensch, scheint sich das Indefinitpronomen man abzuleiten, und es ist ersichtlich, dass sein Bedeutungsursprung „denkendes, aufrecht gehendes Wesen“ nicht geschlechtsdifferenzierend ist.
Erst diesem Wesen, das sich wegen seiner Triebkontrolle und seiner Fähigkeit zu geistiger Unabhängigkeit zum Menschen entwickeln konnte, gab die Sprache den Namen man. Er bedeutet also menschliches Wesen. Damit sind Frau und Mann gemeint. Daraus entwickelte sich der Begriff Mann, der also ursprünglich gar keine erhöhende Abgrenzung zum weiblichen Begriff Frau enthält.
Im Englischen bedeutet man sowohl Mann, Mensch als auch man. Das spiegelt der Begriff mankind wider. Es heißt Menschheit, und es ist selbstverständlich, dass damit die menschliche Art gemeint ist.
Im Lateinischen heißt Mensch homo. In homo enthalten ist homilis, gleich, im Vergleich zu Göttern auch humilis, niedrig – und humus, Erde, das inhaltlich zusammengenommen „der Erdgemachte, der Erdenbürger, der Sterbliche“ versinnbildlicht. Es deutet darauf hin, dass man sich schon in der Antike über den Stoffekreislauf, der sich in der belebten Natur vollzieht, im Klaren war und dass himmlische und irdische Kräfte und Mächte als ein Überbau verstanden wurde, dessen Herrschaft durch die unsterblichen Götter, die Moral und Sittlichkeit vertraten, gewährleistet wurde.
Das lateinische Wort für Mann lautet vir. Es ist abgeleitet von virtus, männliche Tugend, einem Wort, das seinen Ursprung im Namen der Göttin Virtus hat, die für militärische Tapferkeit steht. Dem zugrunde liegt ein Ehrbegriff, der auf den vier Kardinaltugenden Platos gründet: Klugheit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit. Ebenfalls davon abgeleitet ist virgo, Jungfrau, deren Zustand der „Unberührtheit“ man besondere Ehr- und Tugendhaftigkeit als Ausdruck von Widerstandskraft gegen sexuelle Gelüste und Verführungen zuschrieb.
Dagegen liegt die Herkunft des griechischen Wortes ἄνθρωπο, anthrōpos, Mensch, im Dunkel. Es wird angenommen, dass es, aus vorgriechischer Zeit stammend und ohne sprachlichen Bezug zu erkennbaren indogermanischen Wurzeln, eine Bedeutung repräsentiert, die sich möglicherweise aus der aufrechten Haltung und dem vorwärtsgerichteten Gesicht herleitet, Merkmalen, die den Menschen vom Tier unterscheiden. So könnte man in anthropos anti, gegen, und tropos, Wendung, „der Vorwärtsgewendete“ erkennen.
Welches Menschenbild man dem Gendern auch zugrundelegt, in der Sprachgeschichte war schon immer der Mensch das entscheidende Differenzierungsmerkmal, sei es, dass es um die Unterscheidung des Menschen vom Tier ging, sei es, um dem gottesbildähnlichen Menschen seine Vergänglichkeit gegenüber den unsterblichen Göttern, gegenüber Gott, zu vergegenwärtigen. Der generische Widerspruch Mann versus Frau ist darin nicht enthalten.
Ist das generische Maskulinum vielleicht gar keine Frauen-diskriminierende Verkürzung, indem sie vielfältige, unterschiedliche Genus-spezifische Endungen bereitstellt, die dem überall präsenten Englisch fehlen? Gibt die Doppelt-Nennung, die Ikonisierung duch ‚Sternchen‘ und das Binnen-I, gibt deren mündliche Markierung durch unerwartete Pausen der Sprache Verständlichkeit? Ist denn nicht gerade Verständlichkeit das oberste Postulat an Sprache?
Aus dieser Sicht ergibt sich die Schlussfolgerung, dass ein grammatischer Plural weiblichen und männlichen Gliedern gilt. Alle zusätzlichen Kennzeichnungen weiblicher Geschlechtszugehörigkeit hemmen den Sprechfluss hier, führen das Hörverständnis in die Irre dort und beeinträchtigen insgesamt das Textverständnis.
(1) https://www.belleslettres.eu/content/sprache/ikonizitat-geistig-geistlich
(2) „die Person“, „Mensch als Individuum, in seiner spezifischen Eigenart als Träger eines einheitlichen, bewussten Ichs“ (Duden) ist weiblichen Geschlechts, aus lateinsch per sona, durch den Klang (sona, ae f.) hindurch. In der Grammatik bedeutet Person ein grammatisches Merkmal.








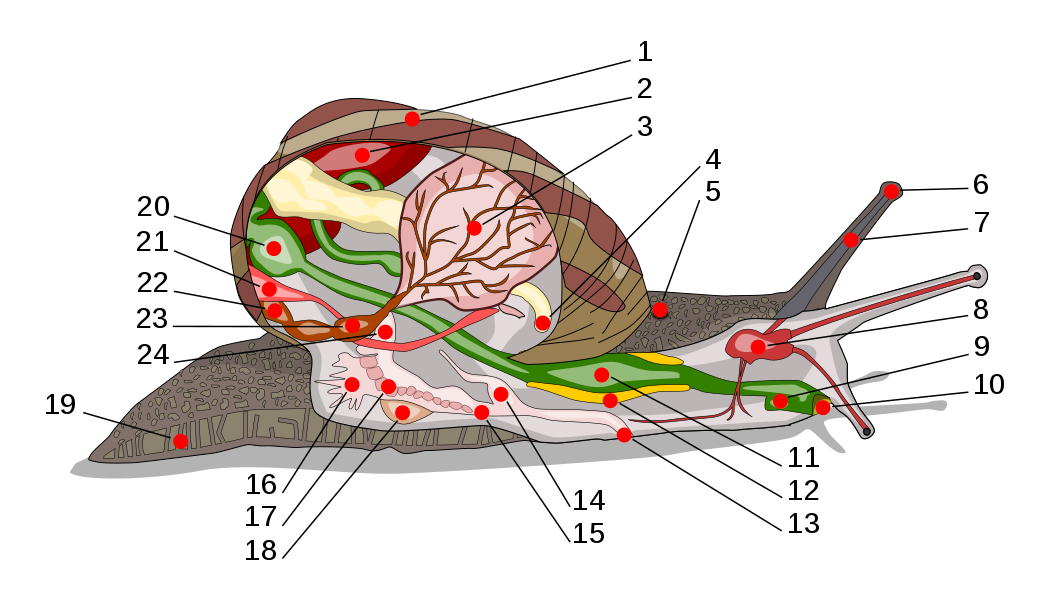
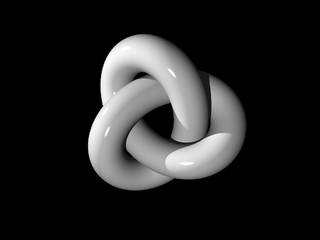

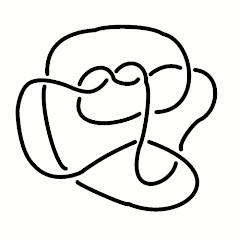

Neueste Kommentare